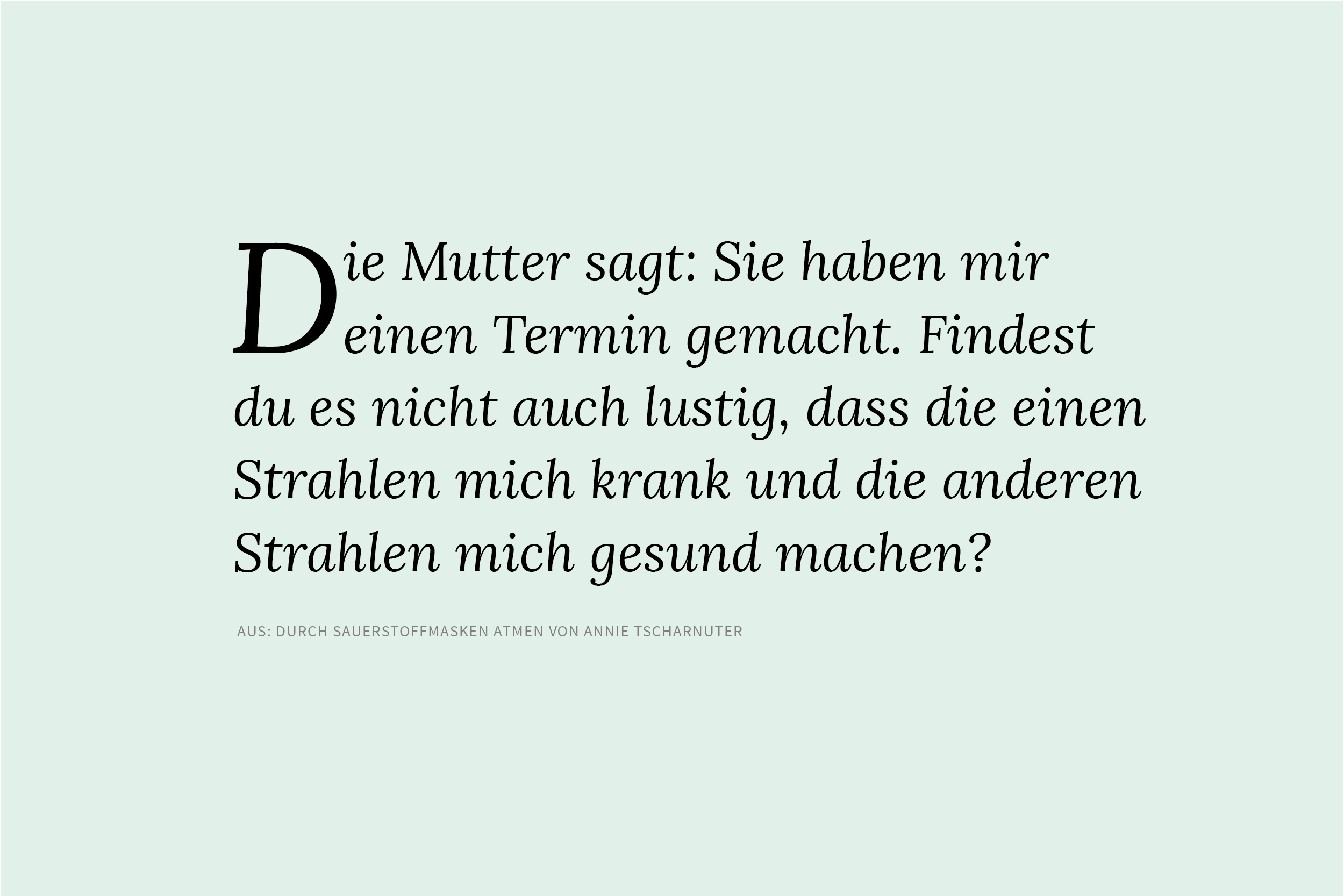Preisträgerin 2018 | 22 Jahre
Sei kein Fisch, sagt Nesli. Aber Amira ist längst einer. Sie sitzen am Fluss. Ob es in dem Fluss Fische gäbe, fragt Amira. Bestimmt, sagt Nesli, es ist ein Fluss wie jeder andere. Auf der Brusttasche von Amiras T-Shirt steht eingestickt: Mermaids don’t do homeworks. Nesli packt Amira am Arm, rüttelt daran, als müsste sie Amira aufwecken. Aber Amira schläft nicht, in ihr wächst nur eine Taubheit. Erst verschiebst du das Treffen, jetzt sagst du nichts, sagt Nesli. Amira sieht ihr ins Gesicht.
Nesli versteckt ihre Augen hinter einer Sonnenbrille, ihre Haare unter einem Hidschab. Sie verschränkt die Arme vor der Brust, sieht nach vorne, auf den Fluss, die Einfamilienhäuser auf der anderen Seite oder auf den Berg in der Ferne oder auf etwas ganz anderes.
Was hast du denn heute früh so Dringendes gemacht? Amira öffnet den Mund, schließt ihn wieder. Es liegt am Herz, sagt sie schließlich, weil das nicht gelogen ist. Am Herz also, sagt Nesli, der Typ aus deinem Studium? – Mirko, sagt Amira. Nesli lacht.
Nesli beginnt am offenen Herzen zu operieren. Amira sieht ihr dabei zu. Und dabei denkt sie an die leere Wohnung. Sie ist kühl und dunkel. Amira hat darauf gewartet, dass jemand etwas sagt, Tschüss sagt, aber es blieb still. Sie hat auch nichts gesagt, hat nur die Tür hinter sich zugezogen, es hat gehallt im Treppenhaus. So oft hat sich Amira an dieser Tür bereits verabschiedet.
Amira erkennt im Halbdunkel des Vorraumes die Schuhe der Mutter, schwarz, das Kunstleder rissig, an Stellen aufgeplatzt. Es sind praktische Schuhe. Amira hält den Atem an, versucht leise zum Wohnzimmer zu gehen, und weiß nicht einmal warum. In dem dämmrigen Wohnzimmer sitzt auf dem Sofa die Mutter. Amira sieht auf ihren Hinterkopf, die grauen kurzen Haare, Amira atmet durch. Die Mutter hat die Beine hochgelegt, die alte Woll-decke, noch von damals, aus Serbien, wie die Mutter manchmal erwähnt, über den Beinen. Die Mutter liest. Du machst dir doch so die Augen kaputt, mach doch wenigstens die kleine Lampe an, sagt Amira und wundert sich, wie streng sie ist.
Die kleine Lampe, die neben dem Sofa am Boden steht und eigentlich Schreibtischlampe ist. Der Hals ganz durchgestreckt, der Kopf zur Decke gedreht, wie eine Blume zur Sonne, wie ein Genickbruch, das Auge milchig; das ist die Glühbirne.
Die Mutter dreht den Kopf, lächelt breit und wirkt trotzdem müde. Die Arme streckt sie von ihrem Körper und sagt Komm her, lass dich drücken, ich bin zurück.
Amira kniet sich auf den Boden, legt den Kopf auf den Schoß der Mutter. Die Bluse hat die Mutter nicht ausgezogen, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, der Stoff riecht immer noch danach. Als wäre sie fünf, so fühlt Amira sich, während ihr die alten Hände der Mutter das Haar streicheln. Was liest du da?, fragt Amira und greift nach dem Buch, das vom Schoß der Mutter gerutscht ist, aber zu groß ist, um in der Spalte zwischen Sofarücken und Sitzkissen zu verschwinden. Vom Teilchen bis zum Pilz.
Jetzt steht Amira auf, um das Licht einzuschalten. An der Decke hängt bloß eine nackte Glühbirne, der Schirm ist vor ein paar Wochen eines Morgens am Boden gelegen, abgefallen, so wie Haare vom Kopf, auf dem Kopfkissen liegen bleiben, auf dem Boden, sich um die Borste einer Bürste wickeln. Amira hat Angst gehabt, ihre Mutter würde aus dem Krankenhaus mit einem kahlen Kopf zurückkommen. Sie hat den Vater angerufen und ihn gefragt, ob er kommen könne, weil die Glühbirne nun nackt sei, ob er das wieder richten könne. Und er hat ja gesagt, aber nicht gesagt wann.
Amira sitzt auf einem Stuhl auf Mirkos Balkon. Ihre nackten Füße zwischen den Stäben des Geländers, der weiße Lack stellenweise abgesprungen, da-runter das kühle Metall. Mirko tritt auf den Balkon und legt eine Schale Weintrauben in Amiras Schoß. Amira hat ihre Haare hochgesteckt, aber ein paar dünne Strähnen sind aus dem Knäuel gerutscht und in den Nacken gefallen. Mirko pustet ihr in den Nacken. Lass das! – Ich lese jetzt übrigens Platon, sagt Mirko. Dann geht er wieder.
Blick auf die Hinterhöfe. Mülltonnen auf Asphalt, Taubendreck. Auf einem der schmalen Balkone steht ein Wäscheständer mit Wäsche. Mirko stellt einen weiteren Stuhl auf den Balkon, für mehr ist nicht Platz. Er setzt sich neben Amira, er baut sich einen Joint. In der Schule habe er sich noch gedacht, wozu das alles, erst im Studium habe er gemerkt, wozu das alles. Er sei spät aufgewacht. Man ändert sich, sagt Amira nach einer Weile. Ja, sagt Mirko, du zum Beispiel bist wie Cinderella in letzter Zeit, musst immer weg und sagst nicht wohin.
Es klingelt an der Wohnungstür. Die Mutter auf dem Sofa ächzt. Ich gehe schon, sagt Amira hastig. Es ist Nesli. Was ist los mit dir?, fragt sie Amira. Ich mache mir Sorgen um dich! Es ist nicht Mirko, wenn es das Herz ist, was ist es dann? Amira steht im Türspalt. Sie sieht die Sorge in Neslis Gesicht. Amira denkt daran, als sie am Fluss gesessen sind. Man sagt, dass Flusswasser kalt sei. Kälte ist zuerst kalt und betäubt dann, so viel weiß Amira. Woher weiß Amira so viel? Na, die Fische werden in den Läden auf Eis präsentiert, die Krebse. Der Krebs. Der Krebs der Mutter. Hör, Nesli, die Mutter züchtete sich einen Krebs, groß und fett. Jetzt isst er sie. Amira kann es nicht sagen, sie bleibt stumm.
Die Nase und der Mund von Amiras Mutter liegen hinter einer Sauerstoffmaske, die fest an ihren Kopf gebunden ist. Bei jedem Atemzug hebt und senktsich ihre Brust, beschlägt das Plastik.
Die Mutter drückt Nesli eine noch verpackte Sauerstoffmaskein die Hand und haucht gegen den Kunststoff: Nimm die, das nächste Mal wenn du hinausgehst! Und dass die Menschen verantwortlich seien, dass die Luft krank mache. Die Mutter sagt, dass Tschernobyl Schuld sei. Dabei tippt sie sich an die Brust. Sie sagt: Tschernobyl ist Schuld daran, dass Dinge wachsen, ohne Kontrolle, wachsen und kaputt gehen.
Sie hört nicht auf, ihre Finger durch den Blusenstoff in ihr Fleisch zu stechen. Ob sie nie etwas gespürt hätte, hatte sie der Arzt gefragt, etwas, das da sei, aber nicht da sein sollte. Aber sie hatte nie etwas gespürt. Sie hat ihre Hände nach der Arbeit nicht mehr gespürt, ihre Füße auch nicht.
Amiras Mutter atmet schwer in den transparenten Plastikschnabel. Amira ärgert sich, dass ihre Mutter so schwer atmet – Mach es nicht schlimmer, als es ist, will sie sagen, aber sie schweigt. Und ihre Mutter lacht in die Maske hinein, Tröpfchen auf Plastik. Auch aus Angst vor Tschernobyl sei sie damals weg aus Serbien, aber jetzt habe sie sich gedacht, habe es sie eingeholt, vielleicht sei alles umsonst gewesen.
Aber dann dreht sich die Mutter zu Amira und drückt Amiras Kopf zu sich an die Brust und sagt: Aber natürlich war es das nicht.
Es tut mir leid, ich wusste nicht, sagt Nesli. Ich kann dir sagen, was ich die ganze Zeit gemacht habe, sagt Amira. Nachdem man durchsichtige Kabel um ihren Körper verlegt hat und ihr eine Nadel in die Ellen-beuge gestochen hat, bin ich zu der Firma gegangen, bei der sie gearbeitet hat. Ich habe gesagt, ich würde gerne den Platz meiner Mutter einnehmen. Man hat mich nicht gefragt, ob ich putzen könne, man hat nur mit den Schultern gezuckt und mir gesagt, ich könne Montag anfangen. Dann sagt Amira noch: Es muss dir nicht leidtun. Nesli hat ihr nie gesagt warum sie letztes Semester von einem Tag auf den anderen einen Hidschab zu tragen begonnen hat.
Amira ist immer froh, wenn sie die Hitze der Stadt beim Betreten des Hauses hinter sich lässt. Im Wohnzimmer sitzt die Mutter auf dem Sofa, sie hat sich die Bluse ausgezogen, sie hat knisternde Aluminium-Folie um ihren Oberkörper drapiert, ihre Haut schaut an manchen Stellen nackt hervor.
Die Mutter sagt: Sie haben mir einen Termin gemacht. Findest du es nicht auch lustig, dass die einen Strahlen mich krank und die anderen Strahlen mich gesund machen? Die Mutter lacht.
Amira sieht zum Fenster. In dieser Richtung, hinter den Wohnblöcken, fließt der Fluss. Sie sieht das Telefon auf dem Fensterbrett liegen. Sie geht hin,nimmt es. Ihre Mutter auf dem Sofa raschelt. Amira hält das Telefon in der Hand und überlegt.
Sie könnte ihren Vater anrufen und ihn fragen, ob er das richten könne, aber was könne man denn noch richten.
(Alter: 22 Jahre)